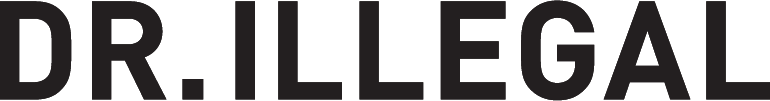Auszüge aus der Fluchtgeschichte von Stephen
(Eine vollständige und überarbeitete Fassung wird in dem in Kürze erscheinenden Buch „Flucht nach Deutschland“ erhältlich sein)
Stephen wird 1974 in Westafrika, in einer kleinen Stadt im Norden Nigerias geboren. Als er zehn Jahre alt ist, erkrankt seine Mutter Felicia. Sein Vater nimmt ihn eines Tages in das entfernt liegende städtische Krankenhaus mit, in dem seine Mutter behandelt wird. Als er seine Mutter begrüßt, ist er über den ernsten Blick seiner Mutter verwundert.
Niemand möchte ihm erklären, welche Krankheit seine Mutter hat, er weiß nichts von dem kritischen Gesundheitszustand seiner Mutter. Er erinnert sich aber noch sehr genau, dass seine Mutter ihn, als sie später allein sind (der Vater muss zur Arbeit fahren), lange und liebevoll anschaut. Sie bricht nach einer Weile das Schweigen, um ein Gebet zu sprechen, segnet ihn feierlich und sagt ihm dann, dass Gott ihn beschützen und dass alles gut werden wird.
Leider kann er zu diesem Zeitpunkt nicht ganz die Bedeutung dieser Gesten und Worte begreifen, denn es sollte das letzte Mal sein, dass er sie lebend sieht. Er erinnert sich an seine Mutter, als eine außerordentlich schöne und gutmütige Frau. Wie Stephen später erfuhr, wurde seine Mutter damals kurz nach seinem Besuch aus dem Krankenhaus in ihr Heimatdorf gebracht. Ihre Verwandten können sie überreden an ihren Geburtsort zurückzukehren, da die behandelnden Ärzte wohl wenig Hoffnung haben, dass Felicia jemals von ihrer Krankheit genesen wird.
Im Dorf wird sie dann von einem traditionellen Heiler behandelt, doch auch die Bemühungen des Medizinmannes sind vergebens, Felicia stirbt. An dem Begräbnis nimmt fast das ganze Dorf teil, die Zeremonie vollzieht ein anglikanischer Priester, Stephen weint und ist niedergeschlagen. Viel Zeit bleibt ihm aber nicht den Tod seine Mutter zu betrauen. Ausgerechnet jetzt muss sein Vater auswärts arbeiten, er kann sich nicht um die Erziehung von Stephen kümmern und schickt ihn aufs Land zu seinem älteren Bruder (dem Onkel Stephens).
Das Dorf liegt weitab von jeder Stadt. Die Dorfgemeinschaft speist sich gleichermaßen aus Muslimen und Christen, traditionelle afrikanische religiöse Bräuche und Zeremonien sind allerdings noch recht lebendig. Das Zusammenleben funktioniert gut, der Alltag ist allerdings sehr spartanisch, denn der Überlebenskampf steht im Vordergrund. Sein Onkel betreibt Landwirtschaft, indem er einige Felder bestellt. Stephen und die anderen Kindern, werden fast wie Sklaven gehalten. Er wird des Öfteren von seinem Onkel geschlagen. Als ich ihn verwundert darauf anspreche, beteuert er, dass sein Onkel kein schlechter Mann war, sondern, dass das Leben auf dem Land unglaublich hart und für uns Deutsche nicht vorstellbar sei.
Wasser muss beispielsweise aus dem Dorfbrunnen oder aus einer Wasserstelle, die etwas außerhalb des Dorfes liegt, geholt und dann in Krügen und anderen Gefäßen transportiert werden. Es geschieht nicht selten, dass fremde Nomaden Wasser plündern, indem sie mit ihren Viehherden die gesamte Wasserstelle nachts aufsuchen und sich bis zum letzten Tropfen dort bedienen. Dann hat das gesamte Dorf kein Wasser mehr und die Jäger müssen ausgeschickt werden, um Wasser zu suchen- manchmal kehren sie erst nach Tagen zurück.
Stephen steht jeden Tag bereits um 5 Uhr in der Frühe auf.
Morgens muss man sehr früh auf die Felder gehen, bevor die Sonne im Zenit steht und Heuschrecken kommen und die niedergefallenen Ären auffressen. Nach wenigen Stunden brennt die Sonne unerbittlich. Auf den Feldern gibt es außerdem Schlangen, Skorpione und Feuerameisen. Stephen erinnert sich auch an schöne Momente.
Da es im Dorf keine Elektrizität gibt- sondern nur Kerosinlampen oder Kerzen, ist der Sternenhimmel ein überwältigender Anblick. Stephens Großmutter väterlicherseits ist eine hervorragende Erzählerin. Manchmal, wenn abends am Firmament die ersten Sterne hervortreten und der Mond scheint - dann sammelte sie alle Kinder, erzählte wunderbare Geschichten von Schildkröten (Stephens Lieblingsgeschichte), Schlangen und anderen Tieren.
An solchen Abenden musste die Großmutter auf Drängen der Kindern bis tief in die Nacht erzählen.
Solche Momente bleiben aber die Ausnahme.